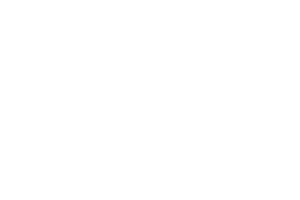„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ Der Automobilpionier Henry Ford hat damit gedeihlichen Partnerschaften den Weg gewiesen. Nur wie kann dies im Alltag – geschäftlich wie privat – tatsächlich gelingen? Fragen an den Sozialpsychologen Professor Dr. Gerald Echterhoff vom Institut für Psychologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Text Marcus Schick
Herr Professor Echterhoff, der Mensch ist nicht gern vollkommen allein, sucht die Nähe zu anderen und mag es, sich in Gemeinschaft zu entfalten – in der Familie, dem Freundes- und Kollegenkreis, in Vereinen und Organisationen. Woher kommt dieses Bedürfnis nach Partnerschaft?
Partnerschaft ist ein universelles Urbedürfnis der Menschheit. Im Vergleich zu anderen Säugetieren ist der Mensch eine extreme Frühgeburt und daher auf sich allein gestellt gar nicht überlebensfähig. Er bedarf in der ersten Lebensphase existenziell einer engen Schutz- und Versorgungbeziehung mit der Mutter beziehungsweise den Eltern. Ein solcher sozialer Mutterleib ist elementar für die ontogenetische Entwicklung der Menschheit und erhöht deren Reproduktionserfolg. Partnerschaft basiert dabei auf Fürsorge, Vertrauen und Zuneigung.
Damit wären ja alle Voraussetzungen für ein überaus harmonisches und friedvolles Miteinander der Menschen gegeben. Was läuft da in der Realität schief?
Soziale Beziehungen sind nicht nur auf Harmonie gebaut. Entwicklungs- geschichtlich gehören wie im Tierreich auch gegenseitige Abgrenzung, Aggression und Wettbewerb dazu. Dass solches „Querschießen“ am Ende nicht selbstzerstörerisch wird, dafür sorgt die kulturell angelegte Fähigkeit des Menschen zur Kollaboration und Kooperation. Wir sprechen in der Sozialpsychologie von „Shared Reality“, die es ermöglicht, zusammen mit anderen kooperative Aktivitäten mit geteilten Zielen und gemeinsamen Absichten zu unternehmen.
Was muss zusammenkommen, um zu sagen „die Chemie passt“?
So ganz eindeutig lässt sich dies nicht beantworten. Die Ausgangszutaten für eine gute und dauerhafte Partnerschaft können schließlich sehr unterschiedlich sein. „Gleich und gleich gesellt sich gern“ ist dabei, so zeigt die Forschung, zutreffender als das Sprichwort „Gegensätze ziehen sich an“. Zumeist greift eine Trias aus drei Faktoren: Ähnlichkeit, Kontakt und Vertrautheit, die eine Art Regelkreis bilden. Menschen zeigen dabei zumeist eine Präferenz für das Vertraute und Sichere anstelle des Unbekannten und Gefährlichen. Hinzu kommt eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Niemand möchte sich in einer unausgewogenen Partnerschaft ausgenutzt fühlen. Dann steigt sehr schnell die Unzufriedenheit.

„Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“
Was hat ein persönliches, privates Partnerschaftsverhältnis mit einer professionellen Partnerschaft zu tun – etwa mit Kollegen oder Kunden?
Die Grundprinzipien und „Mechaniken“ eines partnerschaftlichen Miteinanders unterscheiden sich in vielen Hinsichten nicht im privaten und professionellen Bereich. Im Mittelpunkt steht nach Theorien des Austauschs jeweils die Frage nach der Divergenz oder Konvergenz von Interessen. Je mehr Ähnlichkeit besteht, desto näher können Partner zusammenrücken. Dabei stellt sich dann auch die Frage nach möglichen Alternativen: Gibt es andere, die mir vielleicht mehr bieten? Zum Beispiel mehr Wertschätzung des Vorgesetzten oder der Kollegen. Oder gibt es andere Anbieter, die mir als Kunden ein günstigeres Produkt und auch noch eine bessere Betreuung zukommen lassen? Die Wechselbereitschaft hängt davon ab, wie viel man bereits in eine Beziehung investiert hat. Sind die Wechselkosten hoch, steigt beiderseits die Tendenz, in der Partnerschaft zu bleiben.
Folgt Partnerschaft damit vor allem einer nüchternen Ratio?
Geben und Nehmen spielen in einer ausgewogenen Partnerbeziehung eine wichtige Rolle, sind aber nicht alles. Wenn das Gemeinschaftliche („communal“) von beiden Seiten betont wird, hört das Aufrechnen zugunsten einer langfristigen Perspektive irgendwann auf. Man führt dann nicht mehr Buch über das, was man für den anderen tut. Es überwiegt das gute Gefühl, für das Gegenüber wertvoll zu sein. Diese Entwicklung kann man sich wie zwei Kreise vorstellen: das Ich (self) und die Anderen (others) – je mehr beide Kreise überlappen, bis möglicherweise hin zur vollkommenen Übereinstimmung, desto erfolgreicher, intensiver und dauerhafter entwickelt sich die Partnerschaft. Man steht dem Anderen dann nicht mehr mit Distanz gegenüber, sondern kommt zu einer verschmolzenen Identität. Daran sind natürlich nicht alle gleichermaßen interessiert. Individualisten gehen gern ihren eigenen, non-konformistischen Weg und halten Distanz von kollektivistischem Interagieren.
Wie artikulieren sich die unterschiedlichen Erwartungen ans Miteinander?
Als ultrasoziale Spezies haben Menschen Antennen für soziale Beziehungen. Erfahrungen damit machen wir von klein auf. Wenn ein Kind ein Stück Schokolade möchte, lernt es sehr schnell, dass es oft nicht ausreicht, nur das eigene Bedürfnis zu artikulieren und an Mutter oder Vater zu adressieren. Es muss auch wissen, was in diesen vorgeht, was sie eher glücklich macht oder eher aufregt. Und wie sich ihre Interessen mit den eigenen vertragen. Es braucht also eine mitfühlende Strategie, um ans Ziel, die Schokolade, zu gelangen. Mit anderen Worten: Kommunikation ist im Kleinen wie im Großen entscheidend wichtig für eine funktionierende Partnerschaft. Ebenso wie ein transaktionales Kosten-Nutzen-Verständnis

„Wer kooperiert und ehrlich mit dem anderen ist, hat deutliche Vorteile im Erreichen seiner Ziele.“
Das heißt was?
Die empfundene Ausgewogenheit einer Austauschbeziehung entscheidet über die Beziehungsfähigkeit. Wer sich gut verstanden und behandelt fühlt, hat auch eine größere Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen und mit ihm gemeinsame Wege zu gehen. Das kann dann auch dazu führen, dass sich selbst erbitterte Konkurrenten zusammentun und auf einmal sehr einträchtig und erfolgreich gemeinsame Ziele verfolgen. Wichtige Voraussetzung dafür sind aus psychologischer Sicht Empathie und gegenseitiges Vertrauen. Sich aufeinander verlassen zu können ist Ziel und Anspruch einer funktionierenden Partnerschaft.
Wie entsteht ein solches gegenseitiges Vertrauen?
Essenziell ist eine offene, dynamische und ehrliche Kommunikation, bei der die Ziele und Motivationen des jeweils anderen jederzeit transparent sind. Partner wollen wissen, was der andere will und ob es vielleicht unauflösliche Zielunvereinbarkeiten gibt. Eine ehrliche Selbstoffenbarung ist deswegen ein entscheidender Baustein für gegenseitiges Vertrauen. Dieses Sich-Öffnen schafft oftmals eine neue, positive Konstellation für eine Beziehung – eine kognitive Konsonanz. Wir mögen Menschen mehr, nachdem wir ihnen etwas über uns preisgegeben haben, zum Beispiel über die eigene Familie, die Hobbys oder Vorlieben. Umgekehrt ist es, dass wir einer verschlossenen, distanzierten Person, deren Ziele wir nicht kennen, eher skeptisch gegenüberstehen. Dass derjenige dieses ungleiche Verhältnis vielleicht sogar zum eigenen Vorteil gegen uns ausnutzen könnte, ist nicht gut zu ertragen.
Woran scheitern Partnerschaften am häufigsten?
Sie scheitern dann, wenn das Commitment fehlt, man sich dem anderen nicht mehr verpflichtet fühlt, die gegenseitige Augenhöhe verloren geht und vielleicht sogar attraktive Alternativen bestehen. Amerikanische Psychologen haben das Scheitern einer eigentlich funktionierenden Beziehung in den 60er-Jahren anhand des „Trucking Game“ sehr schön illustriert. Darin versuchen zwei Transportunternehmer ihre Routen so zu optimieren, dass sie ihre Verkehrsflüsse niemals auf einer Einbahnstraße blockieren und damit das System zum Erliegen bringen. Als diese anfingen, allein auf ihren eigenen Vorteil zu schielen und Drohmittel gegeneinander einsetzten, ging das Ganze den Bach runter und beide fuhren schwere Verluste ein. Die Lehre daraus: Wer kooperiert und ehrlich mit dem anderen ist, hat deutliche Vorteile im Erreichen seiner Ziele.
„Essenziell ist eine offene, dynamische und
ehrliche Kommunikation.“
Wie wirken kulturelle Unterschiede auf die Qualität einer Partnerschaft?
Interkulturelle Unterschiede zu kennen und damit empathisch umzugehen, ist für die Kommunikation und das Aufbauen von Nähe und Vertrautheit unverzichtbar. Das ist aber auch ein sehr weites Feld, für das es spezielle interkulturelle Trainings gibt, die in der globalisierten Wirtschaft beim Aufbau von Partnerschaften gute Dienste leisten. So macht es einen Unterschied, ob man mit eher introvertierten und wortkargen Finnen oder mit sehr direkt-fröhlichen US-Amerikanern am Verhandlungstisch sitzt. Gut zu wissen ist auch, dass man in Asien einen Geschäftserfolg nicht der Genialität eines Einzelnen, sondern immer dem gesamten eigenen Kollektiv zuweist. Achtsamkeit, Respekt und Weltoffenheit sowie ein kommunikatives Aufeinander-Zugehen sind in jedem Fall gute Türöffner
Wieviel physische Nähe ist für eine gute Partnerschaft erforderlich?
Physische Nähe ist immer ein positiver Verstärker. Studien zeigen, dass in einer intimen Beziehung beispielsweise Händchenhalten ein messbarer Puffer gegen Stress ist, die Resilienz erhöht und gesund hält. Aber auch ohne direkte körperliche Berührung sind durch Nähe positive Effekte nachzuweisen. Etwa durch Mimik und Gestik – ein Lächeln oder eine einladende Handhaltung – entsteht sozialer Kitt und erhöht sich die Verbindlichkeit von Gruppennormen. Trotz immer besserer und umfassender verfügbarer Kommunikationsmedien, die im Lockdown gute Dienste geleistet haben, ist dafür die direkte persönliche Begegnung nach wie vor unverzichtbar.
Inwiefern können Learnings aus der Corona-Krise dazu beitragen, Partnerschaften neu zu bewerten und ggf. mit einer verbesserten Qualität zu leben?
Die „Teams“-, „Zoom“- oder „Skype“-Konferenzen haben Beziehungen zusammengehalten, die im Lockdown sonst komplett blockiert gewesen wären. Für die Kommunikation in der Gruppe sind dabei ein paar Vorteile schnell sichtbar geworden. In eigenen Online-Veranstaltungen mit Studierenden habe ich erlebt, dass das Ankündigen von Redebeiträgen per Handzeichen oder begleitende Chats dafür sorgen, dass auch Ideen in das Miteinander eingespeist werden, die in realen Runden mit sehr präsenten und dominanten Teilnehmern eher untergehen würden. Dass deswegen Online-Treffen die persönliche Begegnung komplett ersetzen könnten, davon halte ich nichts. Die physische Anwesenheit, das „embodiment“, ist für uns als hypersoziale Spezies so wichtig, dass wir für beständige und belastbare Partnerschaften nicht darauf verzichten können. Zum Beispiel dann, wenn es gilt, sich gemeinsam auf ein Ziel einzuschwören. Das ist wie bei einem Musiker, der perfekt einstudierte Stücke vor Publikum noch mal in einer ganz anderen Qualität spielt –energetisiert. Auf dieses Potenzial sollten wir nicht verzichten.
Und was ist mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz: Könnten diese nicht viel besser und schneller Entscheidungen treffen als Menschen in einer Partnerschaft?
Mit Künstlicher Intelligenz, Algorithmen und Deep Learning können Maschinen sicher sehr gut und viel schneller als Menschen Informationen zusammentragen und Standards abgleichen, um daraus Entscheidungsgrundlagen zu formen. Wenn es aber um das Verstehen, sich Annähern, Committen und vertrauensvolle Miteinander-Agieren geht, ist und bleibt der Mensch als soziales, empathiefähiges Wesen die letzte Instanz. Er ist es, der mit seinem Wissen, seiner kulturellen und sozialen Erfahrung und seinen Werten eine Entscheidung treffen und auch glaubhaft vertreten kann, um andere auf diesem Weg mitnehmen und begeistern zu können. Auf dem aktuellen Stand der Technik kann das einer Maschine nicht gelingen. Ihr fehlen dafür die immateriellen Ingredienzen einer Partnerschaft: Fürsorge, Vertrauen, Zuneigung und empathische Sensibilität.

Prof. Dr. Gerald Echterhoff, Jahrgang 1969, studierte Psychologie in Köln und New York. Seine wissenschaftlichen Stationen führten ihn danach über die Universitäten Bielefeld und Bremen nach Münster, wo er 2010 Professor für Sozialpsychologie wurde. Im Zuge seiner Forschungen hat Gerald Echterhoff immer wieder das Zusammenwirken kognitiver, motivationaler und interpersoneller Prozesse herausgestellt, wobei er auch deren physiologisch-körperliche Verankerung berücksichtigt. Seit 2018 ist er ordentliches Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künsted der Künste.